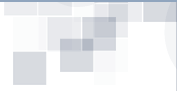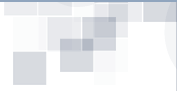Notizen
K i l l e r k i n d e r k l i m a. Jedes Lebewesen ist eines zu viel: Darauf läuft die radikale Kritik der Klimaerhitzung hinaus. Wenn vor dem Verzehr von Tieren und ihren Produkten gewarnt wird, weil die Emissionen der Tiere schädlich seien, wird den Tieren mit dem Recht auf Emissionen das Recht auf Leben abgesprochen. Mancher mag dabei denken, dass diese Tiere ohnehin nur um des Menschen und seines Vernichtungswillens am Leben seien. Doch auch vor den Menschen selbst, denen die von ihnen verzehrten und genutzten Tiere über deren Emissionen zugerechnet werden, macht die Kritik keinen Halt. Denn kein Mensch kann als Essender, Wohnender, Reisender, überhaupt Konsumierender günstig fürs Klima sein. Die Kritik aufs Fliegen oder den Fleischkonsum zu reduzieren, ist dabei eine halbgare Variante, die kaum eine Diskussion wert ist. An der konsequenteren Forderung, keine Kinder in die Welt setzen, lässt sich das Falsche dieser Kritik besser sehen. Denn Mitglieder einer Familie belasten die Umwelt weniger als kinderlose Paare oder gar Alleinlebende. Erstens: In der Familie wird weniger Wohnraum pro Person zur Verfügung stehen als im kinderlosen Haushalt. Selbst der Wachstumskritiker Niko Paech gab kürzlich an, 40 Quadratmeter Wohnfläche zu haben. Welches Familienmitglied kann das von sich sagen? Zweitens: Gegenstände werden in Familien intensiver genutzt als von Alleinlebenden. Drittens: In Familien ist das verfügbare Einkommen pro Person niedriger, was sich auch daran zeigt, dass Familien besonders von Armut betroffen sind. Wer Kinder hat, nutzt also als Einzelperson dem Klima. Die Mängel der Kinderkritik zeigen sich auch in einer Studie, die den Eltern alle Emissionen zurechnet, die ihr(e) Kind(er) und alle nachfolgenden Kinder verursachen. Folgt man dieser Annahme, sind die Kinder, Enkelkinder etc. völlig frei von Emissionen. Womit aber lässt es sich rechtfertigen, dass ein Mensch für die Emissionen anderer Menschen verantwortlich sein soll, ein nachkommender aber nicht einmal für seine eigenen? Am Ende kommt es hierbei wohl nicht auf Logik an, sondern nur auf das diffuse Unbehagen an der Menge an Menschen an sich. Wer dieser Linie folgt, untergräbt aber die Grundlage aller Humanität: dass alle Menschen gleich sind und jeder Mensch das gleiche Recht auf Leben und Emissionen hat, wenn auch nicht auf jede beliebige Menge Emissionen. Praktisch fragt sich schließlich: Wie will jemand noch einen Menschen mit Argumenten erreichen, dem er das Lebensrecht abgesprochen hat? (04.02.2020)
***
K r e d i t k r i t i k. Der Zins wird gelegentlich als Treiber des Wachstums gesehen. Die Notwendigkeit, mehr zurückzahlen zu müssen als man sich ursprünglich geliehen hat, gilt manchen als der Beweis dafür, dass der Zins alleine zum Wachstum führe. Selbst ein Wachstumskritiker wie Niko Paech, der sonst zurecht nicht müde wird, auf die Bedeutung des Massenkonsums für das Wachstum zu verweisen, prangert – in Befreiung vom Überfluss – den Zins an. Diese Theorie ist aus Sicht des einzelnen Unternehmens unplausibel: Dessen Sorge ist in der Regel nicht, den Zins zurückzahlen zu können, sondern wie es durch den Absatz die gesamten Kosten erlösen kann. Dabei darf es vor allem im technologischen Wettbewerb nicht ins Hintertreffen geraten, weil dann der gesamte Absatz auf einen Schlag gefährdet ist. Gegenüber der Abwendung dieser Gefahr ist der Zins meist nur ein nebensächlicher Kostenfaktor, wie die Eigentumsökonomik lehrt. Und soweit der Zins eine Wirkung hat, werden seinetwegen Unternehmen in der Gesamtheit eher schrumpfen als wachsen. Der Zins entzieht den Unternehmen Mittel, die an die Kredit- und Kapitalgeber fließen. Außerdem reizt ein hoher Zins Unternehmen dazu an, Mittel in Finanzinvestitionen zu stecken. Ein an Realinvestitionen und Wachstum interessierter Ökonom wie Keynes kritisierte deshalb den Zins und wünschte „a much lower rate of interest than has ruled hitherto“ (General Theory 24 II). Denn der Zins sei „not self-adjusting at a level best suited to the social advantage but constantly tends to rise to high“ (General Theory 23 V). Der Zins ist kein Treiber des Wachstums, sondern ein Bremser. Deshalb senken alle Zentralbanken in einer Rezession den Zins, um die Kreditaufnahme und damit das Wachstum zu stärken. Ob oder wie weit das funktioniert, sei hier dahingestellt. Jedenfalls wurde noch nie in der Geschichte der Zins erhöht, um das Wachstum anzutreiben. Was mit Wachstum zusammenhängt, ist der Kredit selbst. Dieser führt in der Tat zu einer Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität, und zwar unabhängig davon, ob das Geld durch Banken geschöpft oder – wie bei Vollgeld oder am Kapitalmarkt – nur weitergereicht wird. Zinslose Kredite, wie sie die gescheiterte Bank für Gemeinwohl in Österreich anstrebte, würden zu mehr Wachstum führen, nicht zu weniger. (21.09.2019)
***
V e r t e i l u n g s p r o b l e m. Die Gleichberechtigung leitet sich ideell von der Gleichheit der Menschen ab und will diese real erreichen. Was bedeutet das? In einer Paar-Beziehung und besonders bei der Erziehung eines Kindes ist es meist die gleichmäßige Erledigung von Arbeit, die als Gleichberechtigung verstanden wird: Keine Seite soll der anderen etwas voraushaben. Aber diese Regel löst kaum ein praktisches Problem. Denn was heißt aufteilen? Die einfachste und gerechteste Lösung scheint es, jede Arbeit genau zur Hälfte aufzuteilen. Dazu muss man akzeptieren, dass kaum eine Arbeitsteilung entlang ganzer Tätigkeiten mehr möglich ist. Verspürt jemand noch immer eine Neigung zu einer bestimmten Arbeit, ist ein Ausleben dieser Vorliebe so schwer, weil jede Praxis die Erinnerung ans vergangene Unrecht wachruft. Die Gleichverteilung erhöht jedenfalls gegenüber der früheren Teilung den Arbeitsaufwand, da beide Partner alle Tätigkeiten erlernen müssen und die konkrete Verteilung abgestimmt werden muss. Wenn nun in der Praxis nicht alle Tätigkeiten gleich geteilt werden können – und Schwangerschaft und Geburt werden immer dazu zählen –, dann ergeben sich die Probleme der Bewertung des Werts der Arbeit, mit denen auch die Wirtschaftswissenschaft hadert. Soll man mit Marx jede Arbeit nur nach der Arbeitszeit messen? Oder gibt es Arbeiten, die anspruchsvoller oder widerlicher sind, und deshalb höher bewertet werden müssen: Ist die Reinigung der Toilette mehr wert als die des Kindes? Gibt es einen Bonus, wenn das Kind schreit? Und wie wird die Frau für Schwangerschaft und Geburt entschädigt? Gibt es umgekehrt für die Entwicklung des Kindes bedeutsame Arbeiten, wie eine anspruchsvolle Nachhilfe, die als höherwertig gelten? Oder: Ist überhaupt jede Zeit mit dem Kind anrechenbar? Kann Spielen mit dem eigenen Kind Arbeit sein? Bei der Suche nach Antworten auf all diese Fragen kann jede Beziehung, die zum Partner wie die zum Kind, selbst zur Arbeit werden, ja muss es, um die Gleichverteilung zu berechnen. Doch selbst wenn man die Definition der Arbeitswerte vollständig leistet und dann alles gleich aufteilt: Dann stellt sich für die Gleichberechtigung noch immer ein anderes Problem: Konflikte entspringen nicht nur der Aufteilung der nötigen Arbeit, sondern auch ihrer Bestimmung. Zählt zum Notwendigen nur das Unerlässliche des allzutäglichen Lebens? Was ist unerlässlich? Muss das Kind gereinigt werden – oder: wie oft? Muss man mit dem Kind spielen oder kann es das auch alleine? Welche Wohnung, welche Spielzeuge müssen angeschafft werden? Hier ist es viel schwerer als bei der Regel der Gleichverteilung, eine Regel darüber aufzustellen, was gerecht ist. Die Basis ist viel unbestimmter als der Teiler, der doch immerhin in der Nähe von zwei liegen wird. Bei der Entscheidung lässt sich kaum eine numerische Regel aufstellen, meist wird eine Seite ihre Position räumen müssen. Diese Schwierigkeiten mit der Gleichberechtigung gehen auf ihre Begründung zurück: Die Forderung nach Gleichheit basiert auf der nach Selbstbestimmung, beschneidet jedoch dieselbe. So leben alle, die Gleichberechtigung anstreben, unweigerlich in einem Spannungsfeld zwischen zwei Freiheiten. (25.10.2017)
***
E r f o l g s g e s c h i c h t e. So wenig manche dem Kapitalismus seine Schattenseiten zurechnen, so sehr alles Gute, das in einem nur irgendwie kapitalistisch-marktwirtschaftlichen System hervorgebracht wird. Gern wird aller ökonomischer und sozialer Erfolg in einer sozialen Marktwirtschaft auf den Markt zurückgeführt, nicht auf seine Einschränkung. Dass dieser wahre Erfolg auch auf dieser Einschränkung: auf Gesetzen, Steuern, öffentlichen Diensten, Unternehmen und Subventionen beruht, wird ausgeblendet. Selbst was – wie die Reduzierung der Arbeitszeit oder der Arbeitsschutz – gegen erbitterten Widerstand des Kapitals errungen wurde, macht sich dieses später als Erfolg zueigen; verbleibende Missstände werden dem Staat zugeschoben. Die Anhänger und Anhängerinnen der Marktwirtschaft glauben nicht selten selbst so stark an diese Verklärung, dass sie ehrlich empört sind, wenn in einer Marktwirtschaft das Marktprinzip eingeschränkt wird. Das seien protektionistische Sünden – doch da sie jeder begeht, müssen sie lässlich sein. Dann bleibt nur die Klage, dass keiner unbefleckt ist, aber das lässt manche nur umso entschlossener an die Reinheit glauben. Das Scheitern des Marktes wird denn auch niemals diesem selbst angelastet: der Markt habe nicht versagt, sondern er habe „Voraussetzungen“. Auch geben jene Marktler nur ungern zu, dass es den Staat braucht, sondern lieber einen „Rahmen“. Doch es wird auch so das Eingeständnis offenbar, dass der Markt für sich nicht stabil ist und alleine nicht existieren kann. Wegen dieser inhärenten Grenzen des Marktprinzips braucht es andere, gegenläufige Prinzipien wie Vergesellschaftung, Solidarität, Planung oder Kontrolle. Sobald solche Prinzipien mitwirken, kann man die Erfolge des gesamten Systems nicht mehr dem Markt alleine zusprechen. (13.1.2017)
***
S c h n i t t f o l g e. Die Faszination für das Kino entsteht mehr durch die bloße Geschwindigkeit des Dargestellten als durch das Dargestellte selbst. Gewiss lockt Schönes, Kluges, Kurioses und Erschreckendes mehr Leute ins Kino als ihr Gegenteil, und umso mehr, desto ereignisloser, hässlicher und langweiliger das eigene Leben ist. Doch selbst das Schönste will niemand sehen, wie es wirklich ist, sondern heller, intensiver und schneller als das Leben es je verfügbar hat. Beim Aufstieg und Fall eines ganzen Reiches in zwei Stunden kann kein wirkliches Leben mithalten. Selbst das Entstehen und Vergehen einer Ehe kann für zwei Stunden spannenden Film reichen, und würde er von der eigenen handeln. Die Steigerung dieser Beschleunigung wird im Trailer erreicht. Aus zwei verdichteten Stunden werden zwei hochverdichtete Minuten, aus fünf Schnitten pro Minute zwanzig. Schlimm aber wird es, wenn man den Kinosaal verlässt: mehr als das wieder leuchtende Licht in den Augen schmerzt die wieder dauernde Zeit in der Seele. (25.11.2016)
***
S p r a c h f a l t e n. So sehr ein Dichter eine eigene Sprache braucht, so wenig darf er den Boden der allgemein verständlichen Sprache verlassen. Nur in der richtigen Distanz zum Bekannten entfaltet sich große Kunst. Die Distanz ist bei jedem Dichter eine besondere: ein unerhörter Gebrauch von Adjektiven; ein entrückender Satzbau; unerdachte Bilder. Die spezifische Distanz trägt die Gefahr in sich, dass auch der beste Dichter zu gern mit seinen Pfunden wuchert. Rilke setzte sich so meisterhaft über die Form hinweg, dass er sie vergessen machte. Damit vergab er auch ihre Verdienste, denn wenn eine Endsilbe gar keine Betonung mehr erfährt, verliert das Gedicht an Wirkung. Es ist keine Makel der Form, dass sie Reime und Strophen vorgibt, sondern ihr Vorzug. Brecht brachte umgekehrt den freien lakonischen Ausdruck zur Blüte, der gerade in seiner Nähe zur Alltagssprache brillierte. Doch schließlich vergaß er, dass Kunst ohne Form nicht bestehen kann. Nicht jeder Gedanke ist ein Gedicht. Benn erzeugte einen Rausch von Bildern, der in seiner Häufigkeit erwartbar und unverbindlich wurde. Celans Zauber verrätselt. Den Dichtern ergeht es ähnlich wie den schönen Gesichtern: gerade die Züge, die in der Jugend außergewöhnliche Schönheit verleihen, werden in der Vertiefung des Alters zum Mangel. Das Grübchen, das ein Lachen unwiderstehlich machte, wird zur auffälligsten Falte: ebenso die Verse. (25.11.2016)
***
G e w i n n w a r n u n g. Der Gewinn ist Gott und Teufel der Marktwirtschaft in einem; er entscheidet über ihren Wert und Unwert. Wo Gewinn gemacht wird, ist ein Nutzen vorhanden und wird ein Bedürfnis befriedigt, denn die Kaufenden sind bereit, für ein Produkt mehr als die Kosten der Produktion zu bezahlen. Zudem werden neue Anbieter versuchen, auf die Bühne des Marktes zu treten. Fehlender Gewinn hingegen kann auf fehlenden Nutzen hindeuten. Die gewinngetriebene Leistung der Unternehmen bei der Befriedigung von Bedürfnissen muss anerkennen, wer die Marktwirtschaft angemessen kritisieren will. Doch umgekehrt muss gesehen werden, dass jemandem das Geld fehlen kann, seinen Nutzen auszudrücken, vor allem aber sein Bedürfnis zu stillen. Die Signalwirkung des Gewinns darf auch niemals darüber hinwegtäuschen, dass schon aus marktimmanenter Sicht jeder Gewinn ein Unding ist. Denn wenn der Markt wirklich so perfekt wäre wie in Lehrbüchern herbeigesehnt, gäbe es keinen Gewinn – er wäre auf Null hinabkonkurriert. Gibt es ihn dennoch, zahlen die Kaufenden zu viel. Die Existenz von Gewinn, gar von hohem, bedeutet immer ein Versagen des Marktes. Zur Verwirrung trägt jedoch bei, dass eine klare Unterscheidung zwischen dem für Investitionen notwendigen Gewinn und der tatsächlichen Mehrwertaneigung durch die Abschreibungsregeln erschwert ist. Daher der oft trübe öffentliche Streit, wenn ein Unternehmen hohe Gewinne ausweist und sie als notwendig für Investitionen verteidigt. Ließe sich dieses Notwendige klarer fassen und abtrennen, könnte man, was den Rest angeht, ohne Bedenken rufen: Haltet den Gewinn! (29.06.2014)
***
D o p p e l a g e n t. Der Unternehmer ist Freund und Feind des Wettbewerbs zugleich; er ist loyal zum Wettbewerb nur, um ihn später verraten zu können. Besser als im Wettbewerb zu gewinnen ist allemal, keine Wettbewerber zu haben: „To widen the market and to narrow the competition, is always the interest of the dealers.“ (Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I, Chapter XI, Part III, Conclusion). Wenn kein Unternehmer oder keine Unternehmerin alleine den Wettbewerb ausschalten kann, versuchen sie es gemeinsam im Kartell, doch auch da werden sie jede günstige Gelegenheit zum Verrat nützen. Schon aus dieser allseitigen Illoyalität der Wettbewerber folgt, dass der Wettbewerb für sich alleine ein zum Scheitern verurteiltes Modell ist. (14.06.2014)
***
S e x m o n s t e r. Das Verlangen speist sich aus zwei antagonistischen Quellen: Attraktion lässt uns nach allen Körpern streben, Selektion beschränkt unser Verlangen auf bestimmte Körper. Beide Quellen für sich und gemeinsam begründen Glück und Schrecken der Sexualität. Die Attraktion lässt das allen Körpern gemeinsame Schöne begehren und verweigert keinem Körper die Anerkennung. Dies ist tröstlich: für alle, die fürchten nie begehrt zu werden, und für alle, die es ungerecht finden, wenn Einzelne einen Vorzug genießen – doch können die Begehrenden und Begehrten an ihrer Willkür und Bindungslosigkeit verzweifeln. Die Selektion lässt das besondere Schöne wählen und zeichnet Wenige oder gar nur einen einzigen Menschen vor allen anderen aus. Dies kann ehrlich und beglückend für die Erwählenden und Erwählten sein – doch lässt es viele Einsame zurück und manche Erwählende an der Missachtung der unerwählten Hässlichen verzweifeln. Im Spannungsfeld zwischen Attraktion und Selektion bewegt uns das Verlangen. Beides Glück steht uns offen, beide Schrecken begleiten uns. Und manchmal dünkt es: Monster bist du, wenn du alle haben willst, Monster wenn du die Eine bevorzugst; Monster, solange Du begehrst. (27.04.2014)
***
S o z i a l ö k o l o g i e. So ausgenutzt wie die Erde schon ist, darf sich kein Produktionssystem nur mehr auf das Soziale berufen. Die sozialen Spielräume jedes Systems sind zudem weniger eindeutig als die Endlichkeit der Ressourcen und der Klimawandel. Daraus lässt sich ableiten, dass Ökologie höchste politische Priorität hat. Es wäre dennoch das Beste, die soziale und die ökologische Krise auf einen Schlag, mit einem Mittel lösen zu können. Das wäre möglich, wenn beide dieselbe Ursache haben. Der Kapitalismus kommt als gemeinsame Ursache in Frage – sofern aber damit nur die von ihm voran getriebene Industrialisierung gemeint ist, bleibt die Lage verworren. Die Industrie verschlingt Ressourcen und schädigt das Klima, aber sie kann eine Lösung der sozialen Konflikte erleichtern und ist deshalb auch im Sozialismus gut gelitten. Also muss der Sozialismus genauso eine Balance zwischen Sozialem und Ökologie finden wie der Kapitalismus. Wenn sich ökologische Politik aus diesem Grund agnostisch gegenüber dem Kapitalismus versteht, könnte sie dennoch der Umwelt mehr schaden als eine antikapitalistische, wenn auch umweltvergessene Politik. Eine Entfesselung der Märkte kann mehr Ressourcenverbrauch freisetzen, als sich später mit ökologischer Politik wieder einfangen lässt. Wer eine ökologische Mobilität mit der Bahn will, darf die Bahn nicht durch Privatisierung und Ausschreibungswettbewerb zerschlagen; wer eine Energiewende oder gar eine Reduktion des Energieverbrauchs will, darf sich nicht auf private Anbieter verlassen; wer Gewässerschutz will, darf die Gewässer nicht den Konzernen überlassen. Außerdem sorgt der Markt dafür, dass erwirtschafteter Wohlstand ungleicher verteilt ist: Für ein gegebenes soziales Ziel wie einen würdigen Lebensstandard für alle wird dadurch mehr Produktion benötigt. Eine soziale Politik, die den Kapitalismus in die Schranken weist, gerät so zu einer potentiell ökologischen Politik. Vielleicht weil von vorneherein weniger produziert werden muss. Vielleicht weil bewusst weniger, aber Besseres produziert wird. Vielleicht weil ungewollt weniger produziert wird. Weniger muss es sein. (21.10.2013)
***
S t a a t s e i g e n t u m. Das Eigentumsrecht erheischt die Fiktion des Freiheitsrechts schlechthin, obwohl es das staatlichste aller Bürgerrechte ist. Es verbürgt in der Vorstellung des Liberalismus nicht nur die Freiheit, sondern auch den Frieden. Das voll entwickelte Eigentum lässt vergessen, dass der Weg zu ihm über Gewalt führt. Das spiegelt sich schon in der rohen juristischen Gestalt des Eigentums, dem Besitz: „Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.“ (§854 Bürgerliches Gesetzbuch). Damit aus Besitz Eigentum werden kann, braucht es eine höhere Instanz als die der Eigentümer selbst. Erst der Staat mit seinen Rechtstiteln schafft das Eigentum. Und erst die Staatsgewalt verleiht ihm sein friedliches Erscheinungsbild, indem sie dem Eigentümer die Gewaltausübung abnimmt. Von der Verfügungsgewalt bleibt im kapitalistischen Alltag nur die Verfügung. Der Eigentümer gibt sich nicht nur der Illusion hin, sein Eigentum wäre gewaltfrei, er wirft dem Staat seine Gewalttätigkeit sogar noch vor. Das Schlimmste ist für ihn, wenn der Staat in sein Eigentum eingreift – das dieser geschaffen hat! Auch ein Blick in die Geschichte zeigt, wie sehr sich Eigentümer über die gewaltsame Entstehung ihres Eigentums täuschen. Am Anfang neuen Eigentums steht oft die Enteignung. „Der Raub der Kirchengüter, die fraudulente Veräußerung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigentums, die usurpatorische und mit rücksichtlosem Terrorismus vollzogene Verwandlung von feudalem und Claneigentum in modernes Privateigentum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Akkumulation.“ (Marx, Das Kapital, 1. Bd., 1. Buch, 24. Kap.) Von den Gewaltwurzeln ihres Eigentums wollen Eigentümer so wenig wissen wie von seiner Staatsgewalttätigkeit. (01.09.2013)
***
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s. Bei der Arbeit ruht der Kapitalismus auf zwei Grundpfeilern: dem freien Unternehmertum, das allen als Ideal der Arbeit verheißen wird, und der abhängigen Lohnarbeit, die für die große Mehrheit der Menschen Realität ist. So fundamental sich diese beiden Formen von Arbeit unterschieden und so sehr sie sich für die Menschen als Entweder-Oder darstellen, so eng sind sie im Kapitalismus verbunden. Der Aufbau von kapitalistischen Unternehmen ist nicht möglich ohne abhängige Lohnarbeit. Der Unternehmer kann deshalb seine Freiheit nur verwirklichen, indem er sie anderen nimmt. Je größer seine Freiheit und sein ökonomischer Erfolg sind, desto mehr Unfreiheit von anderen ist nötig. Wenn Unternehmertum das höchste individuelle Ziel des Kapitalismus ist, verstößt seine Umsetzung permanent gegen dieses Ziel, indem die Masse davon ausgeschlossen bleibt. Marx hat dies unter dem Blickwinkel des Eigentums in der ihm eigenen Schärfe festgehalten: „Eigentum erscheint jetzt, auf Seite des Kapitalisten, als das Recht, fremde unbezahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters, als Unmöglichkeit, sein eigenes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar von ihrer Identität ausging.“ (Das Kapital, 1. Bd., 1. Buch, 22. Kap.). Und: „Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums.“ (24. Kap.) Was mit der Enteignung begann und beginnt, spiegelt sich in der Lohnarbeit: durch Abhängigkeit bedingte Freiheit und durch Freiheit bedingte Abhängigkeit. (28.06.2013)
***
G e g e n w e r t. Derivate werden geschaffen, um die ökonomische Bedeutung ihrer Basiswerte zu konterkarieren. Eigentlich sollen Wertänderungen der Basiswerte auch eine Verhaltensänderung der Wirtschaftsakteure bewirken, so zumindest unterstellen es die Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre: Steigende Zinsen sollen die Wirtschaftstätigkeit drosseln, sinkende Rohstoffpreise ein Überangebot anzeigen, Wechselkursänderungen die Leistung einer Volkswirtschaft spiegeln. Doch genau gegen diese theoretisch geforderten und gesamtwirtschaftlich gewollten Wirkungen will sich der Einzelne mit Derivaten absichern. Für ihn soll eine Änderung von Zinsen, Preisen oder Wechselkursen keine Bedeutung mehr haben. Wenn nur wenige Akteure Derivate zur Absicherung nutzen, werden sich Änderungen extrem asymmetrisch auswirken. Wenn aber viele sie nutzen, treten Derivat und Basiswert in eine Konkurrenz zueinander. Sichern sich tatsächlich alle Akteure gegen eine Zinssteigerung ab, würde selbige ins Leere laufen. Zugleich verliert die Orientierung an den Basiswerten ihren Sinn, wenn diese für die Akteure keine reale Bedeutung mehr haben. Der Derivatemarkt und seine Preise bilden dann selbst die Basis des Wirtschaftens, auf die sie sich anfangs nur bezogen haben. Eine Parallelwelt an Absicherungsgeschäften wird dann die eigentliche Welt ersetzen. Für diese Parallelwelt müssen die makroökonomischen Lehrbücher erst noch geschrieben werden. (07.06.2013)
***
U n s c h u l d s w o l f. Der Kommunismus ist eine gute Idee, aber in der Praxis funktioniert er nicht: diesen Gedanken gilt es auf den Kapitalismus anzuwenden. Dem Kapitalismus gelingt es allzu gut, sich von seinen real existierenden Formen zu distanzieren. Spricht man den Sklavenhandel an, wird der Kapitalismus mit Verweis auf die Lohnarbeit als Überwinder gedeutet. Spricht man Imperialismus und Kolonialismus an, wird der Kapitalismus nicht nur zum Friedensprofiteur, sondern gleich zum Friedensbringer erklärt, denn die Kriege führt immer der Staat. Spricht man die Unterstützung von Teilen des Kapitals für den Nationalsozialismus an, wird besonders scharf auf die Antithese von totalitär-sozialistischen und freiheitlich-kapitalistischen Staaten gepocht. Spricht man Ungleichheit an, leben selbst die Ärmsten noch in der besten aller Welten. Spricht man Missstände und Schäden durch die kapitalistische Produktion durch die Jahrhunderte an, ist es vorher immer noch schlechter gewesen. Der Kapitalismus ist nie für einen Missstand verantwortlich, er hat ihn nur noch nicht beseitigt. Dahinter steckt die Reinheit der Idee: weil Markt und Kapital so unschlagbar effizient und gewaltlos sind, muss jeder Missstand eine andere Ursache haben. Oder so marginal sein, dass er als Einwand nicht zählt. Für diese Argumentation eignet sich der Kapitalismus im Gegensatz zum Kommunismus besonders gut. Dem Kommunismus haftet an, er sei tatsächlich und immer totalitär und ihm damit alles zurechenbar, was während seiner Herrschaft sich ereignet. Der Kapitalismus dagegen macht sich klein und versteht sich als bloßes Wirtschaftssystem, das mit dem ihn umgebenden Staat nichts zu tun habe, ihm sogar entgegengesetzt sei. Doch der Kapitalismus braucht den Staat, und sei es nur als Sündenbock für die niemals endenden Missstände. Reicht diese Entschuldigung nicht aus, greift mit dem Individualismus ein anderes Sichkleinmachen: wem es schlecht geht, der ist selber schuld, weil er die Möglichkeiten des Marktes nicht genutzt hat. Mit dem Rückgriff auf Staat und Ungeratene lässt sich die Unbeflecktheit von Konkurrenzprinzip und Kapitalakkumulation noch allezeit beweisen. Wer sich an der Realität orientiert, wird den Kapitalismus nicht so leicht aus der Verantwortung für das entlassen, was mit ihm einhergeht. (09.05.2013)
***
T e i l f r e i h e i t. Wer ausgiebig von der Freiheit spricht, die es gegen Staat und Moralisten zu verteidigen gelte, hat doch bestimmte Formen der Freiheit im Sinn. Es kann die Freiheit sein, seine Meinung kund zu tun; die Freiheit, sein im Markt verdientes Geld für sich zu behalten; die Freiheit, zu rauchen, wo man will; die Freiheit, Auto zu fahren, natürlich so schnell es der Motor zulässt; die Freiheit, Müll zu produzieren und in der Welt zu verbreiten; die Freiheit, anzüglich zu sein und seinen Blicken keine Grenzen aufzuerlegen. Obwohl Freiheit oft nur eine ihrer Formen meint, wähnen sich ihre Verteidiger stets universal. Zugleich neigt die Auswahl zur Bequemlichkeit. Dass auch die Einschränkung seiner selbst oder die Anerkennung allgemeiner Regeln Freiheit sein kann, muss diesem Vulgärliberalismus fremd bleiben. Noch mehr, dass Freiheit die Würde des Menschen nicht nur zur Voraussetzung, sondern auch zum Ziel haben sollte. Wer dagegen Freiheit vor allem als das Verfolgen eigener Interessen oder das Ausleben persönlicher Vorlieben versteht, will nicht sehen, dass mit Zigaretten und Autos nur das begehrt wird, was eine milliardenschwere Werbeindustrie tagtäglich als Freiheit verkaufen muss. Will nicht sehen, dass der Zwang zur Müllproduktion durch den üblichen Konsum uns mehr Einschränkungen auferlegt als jede Mülltrennung. Und schon gar nicht sehen wollen diese Freiheitlichen, dass der staatliche Zwangsapparat die Verletzung des Privateigentums härter ahndet als jede Steuerhinterziehung. Wer hinter Ökosteuer und Wärmedämmung die Diktatur heraufziehen sieht, verwendet seine Meinungsfreiheit kaum für Gefangene, welche tatsächlich Grund haben, den Staat für einen unfreien zu halten. (28.04.2013)
***
W i n – L o s e. Die Hermetik des Marktliberalismus offenbart sich an der These vom beidseitigen Gewinn. Oft wird der Markt damit gerechtfertigt, beide an einem Geschäft Beteiligten würden sich immer besser stellen, sprich: gewinnen, denn sonst würde das Geschäft nicht getätigt. Vorausgesetzt wird dabei, dass der Einzelne die Wahl habe, auf das Geschäft zu verzichten oder ein anderes, für ihn besseres einzugehen; dadurch werde die Gegenseite zu so vielen Zugeständnissen gezwungen, dass sich das Geschäft tatsächlich lohnt. Doch gerade in der Marktwirtschaft ist der Einzelne gezwungen, die Leistung am Markt zu erwerben, und das heißt bei bestimmten Gütern: koste es, was es wolle. Der Mensch braucht nun einmal Essen, also muss er dafür einen Vertrag schließen. Dass er am Ende mit jedem noch so schlechten Preis bessergestellt ist, weil er nicht verhungern muss, belegt nur formal die Win-Win-These – in Wahrheit enthüllt es ihre grausame Abstraktheit. Die Besserstellung als Kriterium ist so formalistisch, dass noch jede offene Zwangssituation darunter subsumiert werden kann. Wenn der Räuber „Geld oder Leben“ fordert, tut er es im Wissen darum, dass sich ein vernünftiger Mensch damit besser stellt, nur sein Geld zu verlieren. Mit anderen Verträgen verhält es sich nicht anders. Zu einem der wichtigsten Verträge, den die Marktwirtschaft kennt und braucht: zum Arbeitsvertrag merkte Max Weber einmal an: „Das formale Recht des Arbeiters, einen Arbeitsvertrag jeden beliebigen Inhalts zu schließen, bedeutet für den Arbeitssuchenden praktisch nicht die mindeste Freiheit in der eigenen Gestaltung der Arbeitsbedingungen und garantiert an sich auch keinerlei Einfluss darauf“ (Freiheit und Zwang in der Rechtsgemeinschaft). Und Schumpeter schrieb schon vor ungefähr 75 Jahren: "In seiner Vollkraft bedeutete [das freie Vertragsrecht] den individuellen Vetragsabschluss nach einer individuellen Wahl zwischen einer unbegrenzten Zahl von Möglickeiten. Der stereotype, unindividuelle, unpersönliche und bürokratisierte Vertrag von heute (...) zeigt keine der alten Merkmale mehr, deren wichtigste unmöglich geworden sind bei Riesenkonzernen, die mit anderen Riesenkonzerenen oder mit unpersönlichen Massen von Arbeitern oder Konsumenten zu verkehren haben." (Zum Problem der Vertragsfreiheit). Solches Realitätsbewusstsein braucht es, um Gewinner und Verlierer des Marktsystems zu erkennen, statt sich der formalen Illusion hinzugeben, dass es im Markt nur Gewinner gäbe. (30.03.2013, ergänzt 21.10.2013)
***
K a t h e d e r k a p i t a l i s t. Professoren, die eifrig eintreten für den Wettbewerb als das effizienteste oder gar gerechteste Ordnungsprinzip für eine Gesellschaft, übersehen allzu leicht den Widerspruch zu ihrer eigenen, praktisch wettbewerbsfreien und auf Lebenszeit gesicherten Existenz als Staatsbeamte. Hans-Werner Sinn, dem beim Thema Arbeit sonst vor allem der Markt einfällt, nimmt dennoch gerne für seine eigene Arbeit und sein Institut staatliche Gelder und Subventionen. Warum tritt jemand so sehr für den Wettbewerb ein, der selbst unter Herausnahme aus dem Wettbewerb seine Leistungen erbringt und finanziert? Sinn sagte dazu einmal: „Forschung ist ein öffentliches Gut. Es besteht deshalb ein Konsens in Europa, dass der Staat die Forschung fördert.“ Dem ist ja zuzustimmen. Warum aber lassen Sinn und seine Gesinnungsgenossen eine Reflektion ihrer eigenen Arbeit und Lebensweise nicht wirklich zu? Sie rationalisieren offensichtlich nicht, dass ihre Leistung und Unabhängigkeit auch auf staatlicher Absicherung beruht. Oder anders gefragt: Warum wird jemand, der in seiner Theorie so viel auf den Markt hält, nicht gleich Unternehmer? Die Antwort darauf darf nicht sein, ihm die Beamtenstelle zu streichen. Sein Leben ist humaner als seine Lehre, denn es beweist, dass neben dem Eigennutzen zumindest noch das Erkenntnisinteresse als Ziel des Menschen exisitiert und ausgelebt werden will. Ein solcher Professor dürfte nur anderen nicht so umstandslos als Höchstes predigen, was er selbst nicht lebt und leben muss. (10.03.2013)
***
G l e i c h v e r p f l i c h t u n g. Der Begriff Gleichberechtigung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Verwirklichung immer auch mit neuen oder neu verteilten Pflichten einhergeht. In der gleichberechtigten Beziehung sind beide Partner zunächst verpflichtet, alle Pflichten gleichermaßen wahrzunehmen. Jede a priori festgelegte Pflichtenverteilung ist unzulässig und alle Abweichungen vom Gleichgewicht müssen verhandelt und gemeinsam entschieden werden. Die Abweichung wird damit aber nicht aus der Welt geschafft, sondern sie wird und muss sich im Alltag ständig ereignen. Sie wird dann immer zur Gegenleistung verpflichten, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt, und sei es nur in Form von Dank. Deshalb braucht es in der gleichberechtigten Beziehung selbst da einen Ausgleich, wo Neigung eine Seite zur Erledigung einer Pflicht treibt. Eine peinliche Berührtheit wird schließlich eintreten, je näher das tatsächliche Ergebnis der früheren, überwunden geglaubten Verteilung kommt. Jede solche Verteilung steht im Verdacht, nur eine Fortsetzung des alten Unrechts zu sein. (02.03.2013)
***
M a s s e n h e l d. Dass große Männer Geschichte machen, wenn sie begnadet sind; dass jeder die Welt verändern kann, wenn der Wille nur da ist; dass Tellerwäscher zu Millionären werden, wenn Sie sich genug anstrengen – solcherlei Fixierung auf die Leistung des Einzelnen kommt allen Ideologien zupass, die den Einfluss der Gesellschaft herunterspielen wollen. Der Einzelne wird groß gemacht, vor allem um zu kaschieren, dass er alleine kaum Wirkung hat und niemals haben kann. Die beste Erfindung bedarf der tausend- und millionenfachen Produktion und Verbreitung durch den gesellschaftlichen Apparat, um wirklich etwas im Leben der Massen zu verändern. Napoleon hatte, wie Brecht bemerkte, wohl auch einen Koch dabei, als er Russland eroberte. Noch immer dient der Kult des Einzelnen dazu, die Massen, die an ihn glauben, der Macht und dem Reichtum Einzelner gefügig zu machen. Es können noch so viele Tellerwäscherinnen an ihre Millionärszukunft glauben, am Ende wird es sehr viele Tellerwäscherinnen und sehr wenige Millionärinnen geben. Erst wenn sich die Einzelnen damit bescheiden, die Begrenztheit ihrer eigenen Leistung und die große Leistung ihrer Mitmenschen anzuerkennen, können sie zurecht stolz sein auf das, was sie sind: Menschen, die alle mehr oder weniger gleich viel dazu beitragen, dass die Erde ein bewohnbarer Ort wird und bleibt. Solange der Tellerwäscher nicht sich und seine heute gewaschenen Teller wertschätzen kann, statt sich an die Zukunft vermeintlicher Millionen zu klammern, wird es keine humane Gesellschaft geben. Die Masse darf nicht an Helden glauben, denen sie nacheifert, sondern muss sich selbst als den Helden begreifen, der sie ist. (17.02.2013)
***
S t a a t s v e r e i n. Carl Schmitt, der unselige Liberalenhasser, wies dennoch mit Recht auf die negative Natur des Liberalismus hin: ohne einen Staat, ohne eine Kirche, ohne eine Moral, gegen die er sich richten kann, ist der Liberalismus politisch nicht überlebensfähig: er kann keine vollständige Lehre der Politik sein. Das Defizit lässt sich auch anders fassen: Der Liberalismus kann den Einzelnen bei Achtung seiner eigenen Grundsätze nicht verbieten, sich zusammenzuschließen, um ihre Interessen gemeinsam zu verfolgen. Selbst ein Liberaler, der mit der Bereitstellung von Sicherheit den letzten Kern des Staates als dessen Aufgabe leugnet, wird sich nicht dagegen stellen können, dass Einzelne sich zu Bürgerwehren oder gated communities zusammenschließen, um für ein bestimmtes Gebiet ihre Sicherheit selbst zu gewährleisten. Was aber, wenn die Bürgerwehren oder gated communities immer größer werden – bis schließlich eine veritable Armee und Polizei von allen in einem größeren Gebiet als Sicherheitseinrichtung, sprich: als Staat anerkannt werden? Ähnliche Ableitungen ließen sich für viele staatliche Einrichtungen finden. Nun kann der Liberale einwenden, diese Einrichtung müsse jederzeit das volle Einverständnis aller Einzelnen erheischen, oder jedenfalls müsse es – mit Rousseau gedacht – einmal am Anfang eine prinzipielle Einwilligung aller gegeben haben, bevor die Mehrheitsentscheidung gilt. Doch ist das zumindest in Staaten gegeben, die man freiwillig verlassen kann. Und viel Wahres ist an der Schuld gegenüber dem Staat, die Sokrates aus dem Aufwachsen in diesem ableitete und die ihn am Ende zum Schierlingsbecher greifen ließ. (17.02.2013)
***
K o n t e r r e v o l u t i o n. Das Scheitern des Antikapitalismus, wie ihn die Linke von 1968 propagierte, lässt sich erst heute ganz ermessen. Hätte die Bewegung Wirkung gehabt, müsste sich zumindest ein Innehalten der kapitalistischen Kräfte seit damals feststellen lassen. Stattdessen begann genau zu dieser Zeit die neoliberale Revolution in Wissenschaft und Politik, in deren Zuge das im real existierenden Kapitalismus an Gleichheit und Zähmung des Kapitals Erreichte ebendiesem Kapital und den Vermögenden geopfert wurde. Es kam zur Entwicklung des Finanzkapitalismus mit der Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen, der Explosion der Finanzderivate, dem Aufstieg der Investmentbanken, Umverteilung und Privatisierungen auf breiter Ebene. All dies bedeutete eine verschärfte kapitalistische Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft, wie sie 68 noch gar nicht vorhanden oder gar vorstellbar war. Nichts hat der Marsch durch die Institutionen an dieser Entgrenzung des Kapitals mit all ihren Krisen verhindern können. Wenn nun Konservative und Rechte die Generation von 68 und ihre Ideen für einen Missstand verantwortlich machen, ist das zumindest in ökonomischer Hinsicht von grotesker Realitätsferne. Das Versagen dieser vermeintlichen Revolution, die sich so leidenschaftlich mit der Gesellschaft beschäftigte, ist nirgends so offenkundig wie dort, wo sie am stärksten hätte wirken müssen: in der Lehre von der Wirtschaft. Besonders diese blieb – leider – vom Antikapitalismus unberührt und den Kapitalisten und Marktfanatikern überlassen. (21.12.2011)
***
G e s c h ä f t s m o r a l. „Deutschland ist das Land der Wurstesser, weil Deutschland das Land der besten Wurstmacher ist. Seine Fleisch- und Wurstwaren haben längst ihren Siegeszug durch die Alte und die Neue Welt angetreten und deutsche Wurstmacher sind in allen Erdteilen als Meister ihres Fachs angesehen und anerkannt. Dieser gute Ruf verpflichtet. Jede Abweichung von der geraden Linie wirkt zerstörend auf die Achtung, die der Wurstmacher genießt. Um die Redlichkeit in der Wurstmacherei zu erhalten, ist die genaue Kenntnis der Gesetze und Verordnungen nötig. Ohne Gesetze und Verordnungen ist keine menschliche Gemeinschaft denkbar und damit auch keine Herstellung und kein Handel mit Lebensmitteln möglich. Es gibt für den Wurstmacher wie für jeden anderen Grenzen, die zu beachten und anzuerkennen sind. Sie sind nicht immer durch den Gesetzgeber gezogen, sondern oft durch das Gewerbe selber, den Käufer usw. Ich erinnere hier an Ausdrücke wie Gewerbeüblichkeit, Ortsüblichkeit, Käufererwartung und dgl. Alle diese, eine falsch verstandene Freiheit der Handlung einschränkenden, geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze muß der Fleischer kennen. (…) Der Kunde muss für sein gutes Geld ehrliche Ware erhalten.“ (Hermann Koch, Die Fabrikation feiner Fleisch- und Wurstwaren, 1959).
***
I n t e l l i g e n z b e s t i e. Eine Gesellschaft stellt man sich mit dem Alltagsverstand doch als etwas Kompliziertes vor. Niemand kommt so leicht auf die Idee, sie mit einem Element oder auch nur wenigen erklären zu können. Erst wer ganze Bücher schreibt, um seine intellektuellen Komplexe zu befriedigen, kann es nicht ertragen, das Eine nicht zu erfassen, das die Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Und statt sich dann wenigstens auf ein Naheliegendes wie soziale Fähigkeiten, Verständnis oder Wille zum Zusammenleben zu kaprizieren, wird bei einem wie Sarrazin ein dem Sozialen gegenüber so Neutrales wenn nicht gar Feindliches gewählt wie die Intelligenz, verbrämt höchstens noch als Bildung. Daraus leitet sich Abscheu gegenüber den Dummen im Allgemeinen – den Arbeitslosen – und den besonders Dummen im Speziellen – den Muslimen – ab. Für solche Denker zerfällt die Gesellschaft, wenn sie ihren Intelligenzwert nicht sorgsam pflege und hochzüchte, deshalb seien zum Schutz des IQ alle Mittel erlaubt. Dass damit die beklagte Spaltung der Gesellschaft verstärkt wird, kümmert nicht. Auch nicht, dass die eugenischen und nationalistischen Zeiten, in denen solche Haltungen bis zum letzten durchexerziert wurden, mit gesellschaftlichen Katastrophen unsäglichen Ausmaßes zusammenfallen. Vielmehr werden gerade solche und andere strenge oder barbarische Zeiten zu einem Paradies verklärt, aus dem der Mensch durch den Sündenfall Zuwanderung in die Hölle der Intelligenzentwertung hinabsteige. Um zu begreifen, wie jemand zu solcher Verklärung fähig sein kann, lohnt sich die Frage, was einen wie Sarrazin im Innersten antreibt. Sein Intelligenzwahn scheint eine Reaktion auf seinen persönlichen Bildungsleidensweg, der von ihm selbst mehr oder weniger offen ausgebreitet wird: der unausgesprochene Traum, ein Bertrand Russell zu sein – und es dann nur zum Beamten und Freizeitstatistiker zu bringen; das jugendliche Trauma, eine Vokabel oder Ableitung nicht beherrscht zu haben – das nun mit umso mehr und umso härteren Sekundärtugenden geheilt werden muss; der Anspruch, ein Bildungsreformer zu sein – mit Vorschlägen, die wie ein halbverdautes Kondensat aus Diskussionen mit der ihm angetrauten Lehrerin wirken; der Apologet der Musterfamilie – der seinen eigenen arbeitslosen Sohn wegschweigen muss. Sein Bekenntnis zu Bildung und Wissenschaft konterkariert Sarrazin, wenn er sich ständig in seinen Argumenten wiederholt oder mit Übertreibungen und Verallgemeinerungen von Einzelbeispielen arbeitet. Sogar seine Zahlenliebe straft Sarrazin Lügen, wenn er den Einfluss des IQ auf die Bildungschancen eines Menschen mal mit „50-80“ Prozent, mal mit „80“ Prozent, mal mit „mindestens 50“ Prozent angibt, dann aber selbst Studien nennt, die von 40-60 Prozent ausgehen, um schließlich einfach zu bemerken, es sei doch für seine Zwecke „egal, ob die Erblichkeit der Intelligenz bei 40, 60 oder 80 Prozent´" liegt. Wenn es so egal ist, wie kann Sarrazin dann ein ganzes Buch maßgeblich darüber schreiben, wie wichtig die vererbte Intelligenz ist? Vollends blamiert er sich, wenn ausgerechnet er mit seinem bornierten Intellektualismus und seinem mäßigen Schreibstil den Untergang des Abendlandes am Untergang des Nachtlieds festmachen will. Da bleibt nur zu hoffen, dass er auch balde ruht und seine Drohung nicht wahr machen wird, noch ein Buch zu schreiben. (04.10.2011)
***
K a p e r l a u n e. Während das Wort „launig“ inzwischen zu den aussterbenden zählen muss und nur der „launische“ Mensch im Alltag überlebt hat, bleibt zumindest in der „Laune“ noch die Doppelsinnigkeit erhalten. Die Grenze zwischen Frohsinn und Wechselhaftigkeit wird nun im politischen Betrieb auf ein Neues von den Piraten ausgelotet. Schon eine andere früher als erheiternd und unverbraucht geltende Partei musste allerdings erleben, in den Sog und zweifelhaften Ruf verantwortungsgeleiteter Positionswechselei zu geraten. Dass dies im Fall der Piraten nicht anders enden wird, ist zumindest nicht unwahrscheinlich, ja der inhaltliche Verfall könnte sogar noch schneller eintreten als bei den Grünen. Anfällig für zukünftige Launen sind die Piraten jedenfalls über das für Parteien normale Maß hinaus. Nicht nur auf ihrem politischen Kerngebiet Transparenz könnten ihre Versprechungen bald im politischen Betrieb zerrieben werden. Von vorneherein haben sie weniger zu verlieren als die Grünen mit ihren Gründungsgroßthemen wie Frieden, Menschenrechte, Atom und Umwelt. Das Netz als solches ist nicht umstritten, die Freiheit darin bei weitem nicht so sehr wie einstmals AKWs. Vor allem aber dürften sich, ähnlich wie lange Zeit bei den Grünen, die liberal-anarchistischen Wurzeln gegen die kollektivistisch-sozialen Blüten durchsetzen. Wer in seinen anspruchsvollsten Momenten auch auf Tocqueville, Popper und sogar Hayek zurückgreift, um seinen Einsatz gegen staatliche Netzkontrolle zu legitimieren und sein Weltbild zu erklären, wird auf Dauer kaum an Grundeinkommen, Mindestlöhnen und kostenlosem Nahverkehr festhalten. Selbst das Bekenntnis zur direkten Demokratie wirkt da reichlich gefährdet. Im schlimmsten Fall ist zu befürchten, dass durch den Erfolg der Piraten die dringend nötigen Maßnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Gemeingüter und mehr Umverteilung einen Schaden erleiden, weil sie dem Einsatz für Freiheit im Allgemeinen und freie Netze im Besonderen geopfert werden müssen. Zu hoffen bleibt natürlich, dass die Piraten so stimmungsvoll und stimmungsresistent wie möglich ihr widersprüchliches Programm vertreten werden. (24.09.2011)
***
K o l l a t e r a l s c h a d e n. Wer die andauernde Finanzkrise verstehen will, muss sich unweigerlich mit dem Sinn und Unsinn von Krediten beschäftigen. Keine Schule der Volkswirtschaftslehre scheint dazu hilfreicher als die Eigentumsökonomik von Heinsohn und Steiger. Sie ersetzt den Markt als Mutter aller ökonomischen Aktitivät durch den Kredit, basierend auf Eigentum als Besicherung. Wenn nur viele oder wenige ihr Eigentum haben, dieses als anständige Besicherung für Kredite verwenden und für diese Kredite dann ökonomisch berechtigte Zinsen verlangen, wird in der Welt der Eigentumsökonomik alles gut. So schaffen Heinsohn Steiger eine Theorie, die – trotz aller daraus erwachsenden immanenten Kritik – das Eigentum und den zinsgetriebenen Kapitalismus noch viel eiserner verteideigen kann als die (Neo-)Klassik und der Keynesianismus. Auch der Kern der Finanzkrise am US-Hypthekenmarkt kann auf den ersten Blick mit unzureichender Besicherung gut erklärt werden. Doch auf die Frage, warum es überhaupt oder zumindest so lange möglich ist, falsche Kredite zu vergeben, bleiben Heinsohn und Steiger eine Antwort schuldig. Denn sie haben nicht nur Markt durch Kredit, sondern den perfekten Markt durch den perfekten Kredit ersetzt. Sie geraten damit auch in dieselben Schwierigkeit wie die Theorie vom perfekten Markt: Sie neigen dazu, ihre normativ-ökonomischen Einsichten als Ist-Zustände zu nehmen, werden blind für das permanente Versagen des Kreditwesens und spielen seine Nebeneffekte wie Akkumalation herunter. Menschen und Banken folgen den Regeln von Heinsohn und Steiger eben viel zu selten und vergeben oder nehmen gerne schlechte und betrügerische Kredite. Deshalb gab es die US-Hypthekenkrise, und deshalb lässt sie sich mit Heinsohn und Steiger weniger gut verstehen als eigentlich zu erwarten wäre. Denn der schlechte Kredit findet keinen systematischen Eingang in ihre Theorie. Natürlich ist ihnen bewusst, dass es den perfekten oder auch nur guten Kredit oft nicht gibt, und sie können es auch scharfzüngig anprangern. Aber sie vertrauen letztlich darauf, dass Kredite im Wesentlichen doch so geschlossen werden, wie sie es sich wünschen. Mit ihrer Theorie fallen Heinsohn und Steiger damit hinter das zurück, worauf sich die Volkswirtschaftslehre heute zurecht immer mehr konzentriert: sich an den Unzulänglichkeiten der Praxis gegenüber der Theorie abzuarbeiten – sei es nun die vom perfekten Markt oder die vom perfekten Kredit. (17.09.2011)
***
V e r f a l l s p r o d u k t. Benn, der Dichter des Verfalls, gedachte einst der Zeit, da „sich alle einer Mitte neigten“. Doch trotz seiner Wehmut und trotz seines gefährlichen Gefallens am „Wogen der Geschichte“ blieb Benn nicht dabei, das schon zu seiner Zeit verlorene Ich zu beklagen, sondern schrieb Hymnen darauf. Mit Sarrazin aber tritt nun einer auf, der zu wissen vorgibt, wie sich das verlorene Ich retten lässt und warum ein Reich zum Abgrund kreist. Er ist sich nicht nur – aus Berichten – sicher, dass goldene Zeitalter und die beste aller Welten existiert haben müssen, sondern kann sogar angeben, wie sich das Goldene und Beste konservieren lassen. In der Einleitung und dem ersten Kapitel seines neuen Buches stellt er gleich mehrere Listen auf, die das Rezept enthalten sollen. Leider lässt Sarrazin dabei aber die von ihm selbst angekündigte Klarheit vermissen. Erst gelten als das Bewahrende solche Elemente wie Religion, Gebräuche, Familie und Respekt vor den Alten – als hätte Platon nicht über die Missachtung des Alters, Walther von der Vogelweide nicht über die Missachtung der Sitten geklagt. Kurz darauf gesteht Sarrazin zu, dass es für die Stabilität einer Gesellschaft gerade um Organisationsformen über die Familie und die Gebräuche hinaus gehe: Hierarchie und Gewaltausübung. Er nähert sich dann mit erschütternder Kaltblütigkeit der Wahrheit über die goldenen Zeiten, wenn er auf die „hierarchisch organisierte Diktatur des Pharaos“ zu sprechen kommt und das „brutal durchgesetzte“ Machtmonopol der Römer beschreibt, ohne freilich konkreter über die permanente Krisen-, Kriegs- und Verfolgungssituation im Römischen Reich aufzuklären. Was an dem darauf folgenden Mittelalter, der Reformation, der Aufklärung oder dem Absolutismus (in dieser Reihenfolge!) überhaupt noch golden war, erschließt sich aus Sarrazins Darstellung schon gar nicht mehr. Dafür schreibt Sarrazin gleich eine neue Liste mit Gründen fürs Goldene: innere und äußere Sicherheit, Legitimationsgrundlage jenseits des Individuums (zu denen für Sarrazin ohne Rücksicht auf den klassischen Liberalismus und Rousseau auch die Volksherrschaft zählt), und – hier kommt ein Neues hinzu – dass gerade dem Individuum Raum für Erwerbstätigkeit gegeben wird. Aus den Höhen der Geschichte taucht Sarrazin nun in die harte und doch seichte Realität der Marktwirtschaft ein. Ganz Ökonom, hat Sarrazin auch keine Hemmung, für seine beste aller Welten die neoliberale Denke der „human resources“ in Anspruch zu nehmen. It's the economy, stupid. Der Gipfel der Wirrnis ist aber erst erreicht, wenn Sarrazin nach einer trotz allem noch differenzierten Darstellung der Bedeutung von Ökonomie, Staat, Religion, Familie, Ideologie, Gewalt, Gesellschaft und Freiheit am Ende des ersten Kapitels schreibt: „Alle Untersuchungen zeigen, dass Volkswirtschaften, Gesellschaften und Staaten umso erfolgreicher sind, je fleißiger, gebildeter, unternehmerischer und intelligenter eine Bevölkerung ist.“ Das ist im besten Fall eine Tautologie, aber tatsächlich ist es eine radikale Verkürzung des Denkens. Strukturelle Probleme, wie sie Sarrazin selbst mit der krisenhaften deutschen Nachkriegsökonomie und der globalen Lohnkonvergenz zunächst noch erwähnt hatte, werden zur quantité négligeable. Ich wage, ohne über das erste Kapitel des Buches hinausgekommen zu sein, ein erstes Fazit: Intelligenz schützt vor Dummheit nicht. Die Geschichte kennt kein „Geschlecht in ewig gleichem Lichte, nun gar der Mensch, sein armer Geist“! (02.10.2010)
***
M o r a l v e r s a g e n. Ein großes Paradox des Liberalismus lautet, dass gerade er, der sich alles vom Einzelnen und seiner Leistung erhofft, für das Gelingen des Gesamten auf ein System im weitesten Sinne, das der Konkurrenz, sich verlässt. Seit Adam Smith gehört es zum guten Ton der Liberalen, auf das Wohlwollen von Metzger, Brauer, Bäcker gerne zu verzichten, solange sie nur ihr eigenes Interesse rational verfolgen – den Rest erledigt die Konkurrenz. Wenn der Deutschlandchef von Goldman Sachs die Verantwortung der Banken für das Gemeinwohl ablehnt; ja selbst wenn ein angeklagter Banker derselben Bank offen in seinen Emails zugibt, es komme ihm nur darauf an, der only potential survivor zu sein, befinden sie sich noch immer in Übereinstimmung mit Smith. Wie groß aber muss der Glaube an das System sein, wenn dieses jede individuelle Gleichgültigkeit, ja Feindlichkeit gegenüber dem fremden und allgemeinen Interesse auszugleichen imstande sein soll? Wie blind muss man sich gegenüber den vielen Formen von Marktversagen, gegenüber der Akkumulation von Reichtum im Kapitalismus, gegenüber der kriminellen Energie der Unternehmen und gegenüber der Ausbeutungstendenz aller Beschäftigungsverhältnisse machen, um an die Befriedigung des Allgemeinwohls allein durch das Eigeninteresse zu glauben? Ohnehin erweist sich der Glaube als Täuschung, wenn man nur den Bestand an Wohlwollen und Interesse beachtet, der doch die Gesellschaft in Wahrheit zusammenhält und der zugleich die unabdingbare Grundlage aller vom Eigeninteresse geleiteten Geschäfte ist. Welcher Metzger, welche Bäckerin könnte ein gutes, dauerhaftes Geschäft führen, ohne den Kaufenden wohlgesonnen zu sein und ohne dieses Wohlwollen auch bei den Kaufenden und bei seinen Geschäftspartnern voraussetzen zu können? Und wenn es möglich wäre: wer könnte selbst glücklich mit seiner Arbeit werden ohne zumindest auch das Bewusstsein haben zu dürfen, seinen Mitmenschen damit etwas Gutes zu tun? Keinen Menschen lässt der Verzicht auf Moral unbeschadet. (03.07.2010)
***
J a h n n g e d e n k e n. Wie seelenlos muss ein Volk sein, das einen seiner größten Menschen und Dichter so wenig ehrt, ja man muss sagen vergisst, wie Hans Henny Jahnn? Seine Werke sind von seltener, erhabener Schönheit und Wahrheit, seine menschlichen und moralischen Qualitäten über jeden Zweifel erhaben. Er war ein Universalgenie und hätte es verdient, an unseren Schulen gleichauf mit Goethe, Hölderlin, Keller, Rilke, Kafka, Mann und Brecht zu beweisen, was Dichtung und Menschsein erreichen können. Aber welche Lernenden erfahren schon von der Existenz Jahnns? Dabei würden gerade sie ihn brauchen, die noch am Beginn ihrer Suche stehen! Ihn, der alles begriffen hatte, früh wie kein zweiter, und dann tapfer wie ein Partisan der feindlichen Welt sein Leben und seine Dichtung abrang. Doch nicht nur die Schulen: wer heute in eine gut bestückte Buchhandlung geht, findet in der Abteilung, die angeblich die Klassiker käuflich machen soll, kein einziges Werk von Jahnn. Es bleibt also beim euphorischen Lob von Kollegen und Kennerinnen oder einem Sonderband. Dabei wiegt eine Seite von Jahnns Werk alles auf, was heute in deutscher Sprache in einem ganzen Jahr gedruckt wird. Es wäre ein Segen für unser Land, statt der vielen überflüssigen Neuerscheinungen die Druckmaschinen zu gebrauchen, um allen Deutschen Jahnns „Perrudja“ oder seinen „Fluß ohne Ufer“ zugänglich zu machen. Das würde die geistige und moralische Erneuerung dieses Landes bewirken, die zurecht so oft beschworen wird. Doch „sie können nicht länger wünschen, daß etwas von Dauer wäre. Sie klammern sich nicht an das Dauernde, das in Wahrheit ihre einzige Hoffnung sein könnte. Sie schaffen millionen Gebilde, aber nicht einen Tempel, in dem das Dauernde verehrt wird als Symbol des erreichbaren Reichtums.“ (22.06.2010)
***
M a r k t m a n i p u l a t i o n. Die Unzulänglichkeit der mathematischen Wirtschaftswissenschaft, unsere Wirtschaft zu beschreiben, beginnt schon im innersten, heiligsten Kern der Mikroökonomie. Am Markt, so die Theorie, träfen sich das gegebene Angebot und die gegebene Nachfrage, deren Interaktion den Markt konstituiere. Der Markt sei kraft der Interaktion das beste Mittel, um den Gleichgewichtspreis als das höchste Ziel des Marktes zu finden. Der Nachfrage liege dabei zugrunde eine Nachfragekurve, die wiederum aus einer Bedürfnisfunktion der Konsumierenden resultiere. Doch schon diese Funktion existiert nur in ökonomischen Lehrbüchern. In der Wirklichkeit dagegen stellt sich der einzelne Mensch als ein Bündel vager, veränderlicher, widerstreitender Interessen und Bedürfnisse dar, das jeder mathematischen Beschreibung spottet. Aber die Wirtschaftswissenschaft überschreitet nicht nur bei der Beschreibung der Bedürfnisse und der resultierenden Nachfrage die Grenzen der zulässigen Abstraktion. Sondern ihr wirkliches Versagen ist, dass sie nicht in ihr Kalkül einbezieht, wie die Angebotsseite in Gestalt der am Markt tätigen Unternehmen, statt nur das Angebot zu stellen, aus dem Bedürfnisbündel der Menschen heraus überhaupt erst ökonomisch verwertbare Bedürfnisse formt und füttert. Die Abermilliarden, die heute für Werbung ausgegeben werden, sind dabei nur der spezielle Ausdruck eines allgemeinen Eingriffs in die Bedürfnisbildung, der mit jedem Angebot einhergeht. Damit werden zwar keine künstlichen Bedürfnisse geschaffen, wie gerne gemunkelt wird, denn verzichtbar ist alles, wenn man nur zum Verzicht bereit wäre. Aber das Angebot verändert ständig die Nachfrage und verschiebt – mathematisch gesprochen – mit der Nachfragefunktion auch den Gleichgewichtspreis. Wie Schumpeter schrieb: "Die neue Ware muss eingeführt werden, d.h. ihre Nachfragekurve muss aufgebaut werden." Einen Gleichgewichtspreis gibt es nicht, denn der Markt ist kein neutraler Vermittler: damit bricht die mikroökonomische Fundierung des Marktes in sich zusammen. (14.06.2010)
***
M e n s c h e n p f l i c h t e n. Mich als einzelnen Menschen haben die Menschenrechte als Anfang und Ziel: meine Würde, mein Leben, meine Freiheit, mein Glauben. Mein Urteil allein scheint deshalb auch in der Frage zu zählen, wie ich meine Rechte zu nutzen gedenke. Jedoch gelten die Menschenrechte für mich genau deshalb nur, weil ich Mensch bin, kein anderes Tier. Mein Menschsein verleiht mir meine Menschenrechte. Unveräußerlich haften sie mir an, mag ihnen auch in der Widerlichkeit der Welt Unrecht widerfahren. Als Mensch muss ich mich für die Rechte meiner Mitmenschen verantwortlich fühlen, denn sie sind mir gleich und dürfen mir also nicht gleichgültig sein. Ich darf es nicht dulden, dass die Widerlichkeit siegt. Will ich dem gerecht werden, muss ich mir und meinen Mitmenschen gegenüber anspruchsvoll sein: keiner von uns darf seine, unsere Menschenrechte mit Füßen und Worten treten. Selbst wenn ich nur mich selbst als Mensch entrechte, entrechte ich alle Menschen. Ich darf deshalb nicht an die Einwilligung der Entrechteten glauben. Menschsein verpflichtet mich auf die Wahrnehmung und Wahrung der Menschenrechte. Ihr Gebrauch durch mich hat immer auch den Menschenrechten aller Menschen zu dienen. (30.05.2010)
***
S p r e c h ü b u n g e n. Dass die Kommunikation durch den Fortschritt ihrer Mittel entzaubert oder gar zerstört werde, gehört zu den Klagen der Fantasielosen. Gewiss ist die Vorstellung unbequem, noch der abgelegenste Mensch könne durch ein Mobiltelefon erreicht, noch das abgelegenste Gespräch plötzlich davon unterbrochen werden. Kennt man heute einen Namen, lässt sich mit einer Suchmaschinensuche vielleicht mehr über den Menschen erfahren als in einem abendlangen Gespräch. Wer sich nicht stört an der Formlosigkeit und Nachlässigkeit des Emailverkehrs, hat keine Ahnung von den Segnungen der Form. Die vordergründige Erleichterung der Kommunikation bringt uns dem Gegenüber oft kein Stück näher – ferner rückt sie dieses aber auch nicht: die Herausforderung bleibt stets die Gleiche. Zudem blüht aus der Veränderung noch für jeden zerstörten Zauber ein neuer auf, schon weil die Erleichterung sich in der Praxis als rechte Täuschung erweist. Bei einer Email ist die Formfrage mindestens so heikel und beglückend wie in Briefen, allein die Betreffzeile kann mehr bewirken als ein zehnseitiger handgeschriebener Brief. Die Namensforschung im Internet mag ein verschwommenes Foto zutage fördern, welches die Spannung auf das genaue Gesicht nur steigert. Das Mobiltelefon schafft nur neue Varianten scheiternder und glückender Erreichbarkeit, immerhin kann eine short message unvergesslich Schönes übermitteln. Wer die neuen Wege der Kommunikation gar nicht zu schätzen weiß, wird auch an den älteren kaum tiefen Gefallen finden. Keiner der Wege verwischt völlig die Spuren dessen, woher jeder echte Austausch kommt und hinmünden sollte: ungestörtes, persönliches Zwiegespräch. (22.05.2010)
***
H a n d e l s g r e n z e. Mit der Vollendung des Weltmarktes wird seine theoretische Begründung, die Freihandelslehre, auf dem Müllhaufen der Ideengeschichte landen. Das Versprechen dieser Lehre, dass durch Niederreißen der Grenzen immer der Wohlstand zunehme, stößt mit dem Planeten an seine eigene absolute Grenze. Dann ist es vollbracht. Nach der Vollendung des Werks müsste die Weltwirtschaft entweder schweren Schaden erleiden, wenn sie zuvor nur durch die Liberalisierung zu Entfaltung gekommen wäre. Oder sie würde prächtig weiterwachsen, ohne auf die ohnehin unmögliche weitere Entgrenzung angewiesen zu sein, was gleichbedeutend wäre mit dem geringen Wert des so mühsam errungenen Weltmarktes. Letzteres scheint die wahrscheinlichere Option. Denn so ökonomisch sinnvoll es ist, dass nicht jeder nur für sich selbst wirtschaftet, sondern mit seinem Nebenmenschen tauscht – so unklar ist, warum nicht bei den meisten Gütern ein Austausch weit unterhalb der Weltgrenze auch schon genügen sollte, um ein gutes Leben für alle gewährleisten zu können. Doch erst mit dem Weltmarkt wird der Beweis erbracht sein, dass das gute Leben weit mehr zu tun hat mit der Art, wie der gemeinsame Handelsraum organisiert ist, als mit der Größe des Handelsraumes selbst. (20.04.2010)
***
M e n e t e k e l. Das Bewusstsein für den Ungeist der Sprache ist verloren gegangen – was dem Ungeist selbst Raum bietet. Hans-Werner Sinn schreibt, Preise und Löhne seien Knappheitssignale, „die die Zuordnung von Menschen und Kapital zu den alternativ verfügbaren Verwendungsmöglichkeiten ... steuern und optimieren“. Wie immer geht der schlampige Umgang mit der Sprache mit dem Ungeist einher. Schon das technische und redundante „alternativ verfügbar“ deutet auf Sinn als den Unmenschen hin, der schließlich Menschen ganz wie Vermögenswerte oder Gegenstände Verwendungsmöglichkeiten zugeordnet sehen will. Dass solche Formulierungen offensichtlich heute akzeptabel sind, bedeutet auch, dass Sinn, auf die Formulierung angesprochen, daran festhalten würde. Er beschreibe nur exakt, was sei, würde er zunächst wohl antworten, um dann – ohne Einsicht – zuzugestehen, dass das „nur so ein Ausdruck“ sei und er selbstverständlich Menschen nicht Gegenständen gleichsetzen wolle. Recht hätte er mit seinem Ausdruck natürlich insofern, als er den bestehenden Verhältnissen angemessen ist. Dass Sinn damit aber auch diese Verhältnisse formt und erhält, dass Menschen auch durch diesen Ausdruck und das dahinter stehende Bewusstsein zu den Gegenständen werden, als die Sinn sie nur zu beschreiben meint, kann er mit seinem verengten ökonomischen Horizont nicht fassen. Und dass auch seine Arbeit gewogen und für zu leicht befunden werden könnte, wenn es den Staat als seinen Arbeitgeber und Großförderer nicht gäbe, irritiert ihn nicht im Geringsten in seinem Glauben an die Entscheidungshoheit des Marktes über den Wert der Menschen und ihrer Arbeitskraft. Solange dieser Glaube und die entsprechende Sprache fortbestehen, wird der Wert unserer Wirtschaft und Gesellschaft der Mehrheit der Menschen verschlossen bleiben. (30.03.2010)
***
M a r k t w e r t. Der Glaube der Neoliberalen an die Unfehlbarkeit der Märkte ist angeschlagen, aber nicht vergangen. Dies gilt auch für das Herz des Marktes, die Preisbildung. Kürzlich sagte der Chicagoer Ökonom John Chochrane ungerührt: „Ich weißt nicht, was eine Blase ist. Niemand kann sagen, ob die Kurse zu hoch sind.“ Preise werden hier reduziert auf ihr subjektives Element: die Einschätzung des Individuums. Die Gesamtheit der Individuen als Markt bestimmt dann den Preis einer Ware, einen exogenen Wert abseits der subjektiven Einschätzungen gibt es nicht. Der Preis ist damit immer mit dem – aktuellen – Wert identisch. Ändern die Individuen ihre Einschätzungen, ändern sich Preis und Wert der Ware. Und der Markt kann so gar nicht falsch liegen. Diese Sicht ist hermetisch, auf den ersten Blick kann sie sogar theoretisch unangreifbar wirken. Abgesehen von ihren in der Ökonomie diskutierten Schwächen wie bei Informationsasymmetrien wird jedoch bei näherem Betrachten auch deutlich, dass dabei der Subjektivismus nicht konsequent zu Ende gedacht wird. Denn das Individuum würde von sich nicht behaupten, mit seiner Einschätzung immer richtig zu liegen, so wie es die Neoliberalen vom Markt als Ganzem annehmen. Das Individuum wird vielmehr davon überzeugt sein, irren und falsche Entscheidungen treffen zu können und getroffen zu haben. Aus seiner Sicht sind Preis und Wert einer Ware nicht identisch, zumindest im Nachhinein. Und das Individuum wird immer wieder sagen müssen, es habe sich über den Wert einer Ware aus Unkenntnis oder aus Enttäuschung über den tatsächlichen Nutzen geirrt und deshalb einen zu hohen Preis bezahlt. Dieses Irren, dieses subjektive Auseinanderfallen von Wert und Preis ist es, was die Neoliberalen nicht wahrhaben wollen. Denn wenn das Individuum irren kann und muss, kann und muss es auch der Markt, wenn er doch nur aus den Einschätzungen der Individuen besteht. Dann muss es auch möglich sein, einen Preis objektiv als zu falsch einzuschätzen, bevor der Irrtum dem Individuum offenbar wird. (21.02.2010)
***
S a n d b u r g e n. Im Kern der Finanzkrise stehen die zu riskanten Kredite, die durch Kreditvergabe an Menschen ohne Sicherheiten entstanden. Für diese Vergabe gibt es vier Schuldige: die Nehmer, die gierig waren und ihre Finanzkraft überschätzten; die Geber, die gierig waren und die Gier der Nehmer ausnutzten; die Politik, die eine laxe Kreditvergabe begünstigte und die Finanzmärkte liberalisierte; und die liberalisierten Finanzmärkte, die aus Krediten eine Handelsware machten und eine risikolose Kreditvergabe vorgaukelten. Wer diese Entwicklung jetzt als verfehlt geißelt, muss sich zu allen Schuldigen äußern. Er darf nicht nur die Gier der Banken und die Gaukelei der Finanzmärkte anprangern, sondern muss sich auch zu den Nehmern und der Politik äußern. Denn natürlich hat der Weiterverkauf der Kredite die Krise verstärkt und verkompliziert. Aber die Wiederholung einer solchen Krise lässt sich nur verhindern, wenn es keine zu riskanten Kredite gibt. Stabilität im Finanzsektor ist nur möglich bei besicherter, begrenzter Kreditvergabe. Bestimmte Menschen müssen augeschlossen bleiben von bestimmten Krediten, sonst bringen die Ausfälle Banken zu Fall. Doch kaum einer geht mit dieser Erkenntnis konsequent um. Die kapitalistischen Regierungen bringen die Banken dazu, weniger Kredite zu vergeben, indem die Eigenkapital-Anforderungen erhöht werden; zugleich erregt man sich darüber, dass die Banken nicht genug Kredite vergeben und denkt schon wieder über erzwungene Kreditvergabe nach. Aber auch linke Regierungskritiker sind oft nicht besser: sie prangern die Risikokredite als eine Krisenursache an, sprechen aber die Kreditnehmer selbst von aller Schuld frei und geben sie allein der Finanzwirtschaft. Diese Exkulpation der riskanten privaten Kreditnehmer lässt die Linken dann bereitwillig einer riskanten öffentlichen Kreditaufnahme zustimmen. (31.10.2009)
***
S c h u l d f r a g e. Dass der Kapitalismus uns in die ökologische Krise führt, steht außer Frage. Doch er tut dies, weil er als ökonomisches System so erfolgreich ist bei der Ausbeutung von Ressourcen und der industriellen Produktion von Gütern. China führt dies gerade wieder vor, mag dort der Erfolg auch nicht ungetrübt sein und mag er auch auf mancher Vorleistung des Kommunismus beruhen, wie Amartya Sen festgestellt hat. Im Angesicht dieses Erfolges bleibt der Linken im deutschen Wahlkampf nichts anderes übrig als die Grünen im ökologischen Eifer zu überbieten: mit radikalen Forderungen zu Atomausstieg und Klimaschutz, mit Tempolimit und Ökolandbau will die Linke den Kapitalismus überwinden und verabschiedet sich so vom sozialistischen Traum, den Kapitalismus industriell in den Schatten zu stellen. Aber im Gegensatz zu den Grünen kann die Linke nicht glaubhaft machen, wie sie zu ihrem Eifer kommt. Immer noch will sie zuvorderst "eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen", sprich: sie will den alten Anthropozentrismus fortsetzen. Nur die Grünen denken die Kritik an der industriellen und anthropozentrischen Prägung von Kapitalismus und Sozialismus zuende, wenn sie den alten Gesellschaftsvertrag als "zulasten der Umwelt" bezeichnen. Und sie stellen auch offen die Frage, gegen welches ökonomische Modell sich die Ökologie besser behaupten kann – der Kapitalismus ließ sich dabei in der Vergangenheit nicht weniger schlecht besiegen als der Sozialismus. Zwar plagt die Grünen umgekehrt ihr soziales Gewissen, aber sie lassen sich deswegen nicht dazu hinreißen, die Linke in sozialen Fragen zu überbieten. Wenn der materielle Fortschritt die Ressourcenausbeutung erfordert und wenn die Ressourcen endlich sind, dann ist auch der materielle Fortschritt endlich. (29.09.2009)
***
G e f ü h l l o s. Die Wirtschaftswissenschaft ist eine beschränkte Wissenschaft - dass dies immer wieder vergessen wird, trägt zu den verschiedenen Krisen unserer ökonomisierten Lebenswelt bei. Der wichtigste Grund für die Beschränkung ist: die Wirtschaftswissenschaft setzt den Menschen voraus, wie er ist. Mit seinen Wünschen. Mit seinen Schwächen. Mit seinen Gefühlen. Mit seiner Vernunft. Aber vor allem: mit seiner Freiheit. Nicht nur die unselige Mathematisierung in der Wirtschaftswissenschaft unserer Zeit muss dabei scheitern, den Mensch zu erfassen. Wer sich aber nur mit Wirtschaftswissenschaft beschäftigen will, um ihren Wert zu bestreiten, wird wenig dabei gewinnen. Zudem setzt jede intellektuelle Bestreitung soviel ökonomisches Denken voraus, dass die völlige Bestreitung unmöglich wird. Dies heißt nicht, dass eine völlige Bestreitung unmöglich ist - aber dies setzt ein Maß an intellektuellem Verzicht voraus, das zu leisten die allerwenigsten bereit sind. (29.09.2009)
***
S t i l l g e s t a n d e n. Mit der drohenden Klimakatastrophe wird trotz aller Versprechen, die hinter den Erneuerbaren Energien stehen, die Frage aufgeworfen: ob es überhaupt möglich ist, eine Produktion, Fortschritt, ja Tätigkeit zu erreichen, ohne zuviele Ressourcen zu verbrauchen? Wenn gerade die Engagiertesten unter den Klimaaktivistinnen sich über ihre eigenen Vorgaben hinwegsetzen müssen, um zu internationalen Treffen zu fahren, lässt sich das nicht einfach mit dem Hinweis auf die umweltpolitische Effektivität dieser Umweltverschmutzung entschuldigen. Der von konservativer Seite vorgebrachte Vorwurf, fast niemand würde die lebenspraktischen Konsequenzen der Klimaschützerinnen tragen wollen, kann nicht ernst genug genommen werden. Und wer es dann ernst meint mit seinem Engagement, der wird sein Leben auf den Prüfstand stellen und sagen müssen, auf was er alles verzichten kann: Auto, Fliegen, Reisen, Elektrogeräte, Internet, Bücher, ja grundsätzlich alles, was wir konsumieren? Dass jemand, der lesend den Tag im Park verbringt, dem Klima freundlicher ist als jemand, der einen Tag lang am Computer und im Netz tätig ist, greift die Möglichkeit eines umweltpolitischen Aktivismus im Kern an. Denn je erfolgreicher eine Kampagne wird, desto mehr steigt auch der Ressourcenverbrauch an. (28.08.2009)
***
D i e b e s g u t. Dass die aktuelle Krise, hervorgegangen aus einem Überfluss an Geld und Kredit, nun wieder mit mehr Geld und Kredit bekämpft wird, lässt an der kapitalistischen Vernunft verzweifeln. Diese Maßnahmen laufen selbst der wohlwollendsten Interpretation der Krise zuwider. Denn gegeben den Fall, dass die neuen Mittel der Geldbeschaffung wie Derivate, Verbriefungen oder Zweckgesellschaften tatsächlich vorher eine geraume Weile zu einer Förderung der realen Wirtschaft beigetragen haben, hätte es sich doch um einen der Zukunft gestohlenen Erfolg gehandelt. Es ist durchaus zugunsten des Kapitalismus anzunehmen, dass ein solcher Diebstahl vorliegt, reicht doch soweit die kapitalistische Vernunft noch allemal, dass sie den momentanen eigenen Vorteil nicht verkennen lässt. Also wohlwollend gedacht, wäre das einzige Mittel zur Bekämpfung der Krise der Verzicht: nicht als moralisches Gebot, das er auch sein müsste, sondern als rein ökonomisches, gegen das zu handeln sich nicht rechnen wird. Nur so ließe sich das der Zukunft Gestohlene wiedergutmachen, damit wenigstens in der Zukunft wieder das Normalmaß erreicht werden könnte. Mit noch mehr Geld und Kredit aber werden die übernächsten Generationen herangezogen, um den Diebstahl an der nächsten Generation zu bezahlen. Läge allerdings kein Zukunfts-Diebstahl vor: hätten sich nur Einzelne auf Kosten der Mehrheit - und auch auf Kosten eines Teils der kapitalistischen Elite - bereichert, wäre der Diebstahl nur umso größer und unentschuldbarer. (05.08.2009)
***