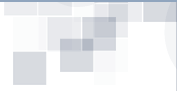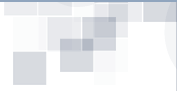Allgemeines Natur
1 - Die Natur ist das Gleichgewicht allen Lebens, welches auch eines des Schreckens sein kann. Der Vulkan zerstört, doch er vollbringt nur sein natürliches Werk und seine Asche kann neues Leben schenken; ein Tier muss sterben, dass ein anderes leben kann. Auch der Mensch ist diesem Gleichgewicht unterworfen. Auch er kann nicht leben, ohne zu töten und zu zerstören.
2 - Der Mensch ist Teil der Natur und Teil der Welt. Dass er dennoch oft von Umwelt und Umweltschutz spricht, verrät seinen anthropozentrischen Blick. Auch heute noch handelt er viel zu oft, als ob er eine eigene, unabhängige Welt und von einer anderen, fremden umgeben wäre. Um diesen Frevel zu begreifen und, dass Umweltschutz immer Weltschutz und menschlicher Selbstschutz ist, hat es erst des Klimawandels bedurft. 3 - Wenn der Mensch Teil der Natur ist, wird es zunächst fraglich, ob er sie überhaupt zerstören kann, oder ob nicht alles, was er tut, zum natürlichen Gleichgewicht und zur Veränderung gerechnet werden muss. Aber so sehr der Mensch Teil der Natur ist, so sehr hebt er sich durch seinen größeren Geist und sein besonderes Mitleid vom Rest der Natur ab.
4 - Der Mensch muss sich als das übernatürliche Wesen begreifen, das er ist. Anders als die Natur kann er etwas als Zerstörung wahrnehmen. Deshalb kann er auf die Zerstörung verzichten, welche die Natur oft selbst so gnadenlos vollbringt, und die Natur schützen.
5 - Gerade weil der Mensch sich gegenüber den anderen Lebewesen auszeichnet, soll er die Tiere nicht als Objekte seiner Ausbeutung betrachten, sondern sie als Lebewesen achten und ihnen Rechte gewähren. Er kann den tödlichen Kreislauf der Natur durchbrechen und auf den Verzehr des Tieres verzichten. Philosophie
1 - Als Lehre vom guten Leben und der guten Gesellschaft bleibt die Philosophie zu allen Zeiten unverzichtbar. Auch wenn es - wie jetzt - gilt, die Welt vor der Katastophe zu retten, braucht es dafür einen Grund, der über die Weltrettung als solche hinausgeht. Wir leben nicht dafür, für das Gute zu kämpfen, sondern für das Gute selbst. 2 - Was gut ist, bleibt der Willkür und Strahlkraft unseres Gewissens überlassen. Es gibt keinen Weg, das Gute zu begründen, weil das Gute eben der höchste, nicht mehr von einem Anderen abgeleitete Wert ist. 3 - Wer sich auf das Gute beruft, muss auf das Gewissen vertrauen. Das Gewissen ist nicht bloß eine natürliche Veranlagung; es bildet sich auch an der Idee des Gewissens, die von den Menschen und der Gesellschaft gepflegt wird. Je höher die Idee des Gewissens gehalten wird, desto realer das Gewissen. 4 - Tugend ist Mäßigung, nicht Verzicht oder Exzess. Das Maßlose im Negativen wie im Positiven führt in die Unwahrheit, weil es unserer Natur widerspricht. Und ohne Wahrheit kann die Tugend nicht bestehen. 5 - Die erste Verfehlung ist die schlimmste, die zweite die leichteste. Ist die allgemeine Regel ein einziges Mal gebrochen, kann sie nicht mehr wirklich allgemein sein: die Unschuld ist dahin, das Paradies verloren. Die Rückkehr ist unmöglich, der Widerstand ewige Herausforderung. 6 - Doch nicht nur am Anfang ist die Verfehlung unendlich: Wie Konfuzius sagt, kann eine schlechte Tat tausend gute aufwiegen. Das Schlechte senkt die Waage immer auf seine Seite. Das zählt zu den Furchtbarkeiten des Lebens. 7 - Moral ist die Stärke, Liebe die Schwäche des Herzens. Am leichtesten hilft es sich mit kaltem Herzen, am besten liebt es sich mit heißem. Die Liebe zu allen Menschen verlangt viel Kraft, aber bleibt an der Oberfläche. Die tiefe Liebe zu wenigen, zu einem Menschen muss viele Menschen vergessen machen. 8 - Leben setzt die Befriedigung des eigenen Interesses voraus. Dieses eigene Interesse lässt sich nicht völlig mit dem fremden versöhnen. Dennoch wären wir nicht, gäbe es nicht Menschen, die unser Interesse zu dem ihren gemacht haben und machen. Dadurch wird auch uns zur Verpflichtung, im fremden Interesse zu handeln. 9 - Unser Verständnis des fremden Interesses leiten wir aus dem des eigenen ab, denn nur dort können wir einen allgemeinen Begriff von Interesse bilden, der sich dann auf uns und andere Menschen übertragen lässt. Schon daher rühren die Grenzen aller Moral. 10 - Handeln wir im fremden Interesse, dann handeln wir moralisch, mag auch dieses Handeln dem eigenen Interesse früher oder später einmal von Vorteil sein. Im Leben verblasst die Grenze zwischen Eigenem und Fremdem oftmals, ohne die Kluft dazwischen je vergessen zu lassen. 11 - In jedem Menschen gibt es den unstillbaren Wunsch, moralisch zu handeln. Niemand kann sich heute dem Interesse des anderen Lebewesens, solange es ein menschliches ist, völlig entziehen, ohne sich selbst seelischen Schaden zuzufügen.
12 - Aus dem Streben nach persönlicher Moralität erwächst auch das nach gesellschaftlicher. Der Einzelne nimmt nicht nur Schaden, wenn er persönlich das Interesse des anderen verleugnet; auch ein System, in welchem das Interesse des anderen keine Rolle spielen soll, wird ihn nicht unversehrt lassen.
13 - Die kapitalistische Wirtschaft ist unfähig, das menschliche Streben nach Moralität zu erfüllen. Sie reduziert alle Menschen zu arbeitsteiligen Sklaven des Gewinnstrebens und der persönlichen Entfaltung, ohne dass der meist kleine Gewinn und das private Vergnügen der Seele einen Raum böten, sich als Mensch im edlen Sinne begreifen zu dürfen: Mensch mit Idealen und Selbstlosigkeit. 14 - Ein moralisches Ziel muss für alle Menschen erreichbar sein. Nicht dass jeder es erreichen müsste - aber wenn sich aus dem Ziel ergibt, dass nur wenige es schaffen können, ist es kein moralisches. Ruhm und Erfolg sind deshalb unmoralisch, denn beide leben von Exklusivität. Politik
1 - Politik ist die Ordnung des Gemeinwesens. Wo Menschen nur ohne gemeinsamen Zweck nebeneinander leben, wo Macht nur zum privaten Nutzen eingesetzt wird, da ereignet sich keine Politik. Erst der Anspruch, das Gemeinwesen zu ordnen, macht Handeln und Denken politisch. 2 - Politik soll beim Einzelnen beginnen und zum Gemeinwesen führen. Eine Vereinigung der Einzelnen zu einer Gemeinschaft ist so unumgänglich, dass der Einzelne nicht ohne diese gedacht werden kann. Dass der Einzelne dennoch den Anfang bildet, ist dem Bewusstsein geschuldet, welches nie das der Gemeinschaft sein kann, sondern dem Einzelnen vorbehalten ist.
3 - Der Mensch ist, ob er es will oder nicht, ein Gemeinschaftswesen. Vieles spricht dafür, dass er es auch will. Niemals hat ihn nur der Krieg der Wölfe in die Gemeinschaft getrieben, immer muss es die Freude am Dasein des anderen gegeben haben, der das eigene Dasein erst verbürgt. 4 - Nicht jedes Handeln mit Bezug zum Gemeinwesen ist politisch. Aber genausowenig ist der Ordnungsanspruch so zu verstehen, dass das Gemeinwesen zu seinem Besten geordnet wird. Auch eine Ordnung, die den Einzelnen Zwang antut, ist eine Ordnung. Wohlgemerkt: hier ist nur ausgesagt, dass dies Politik ist, nicht dass Politik so sein soll. 5 - Ordnung kann durch Zwang oder durch Einsicht erreicht werden. Die Ausübung von Macht, nach Weber die Fähigkeit andere gegen ihren Willen für seine Ziele einsetzen zu können, ist immer Teil von Politik. Aber Teil ist immer auch die Fähigkeit, andere von seiner Legitimität zu überzeugen. Politik ist Kampf um Macht und Legitimität. Wirtschaft
1 - Jede Gesellschaft und damit jede Wirtschaft gründet auf einem einigenden moralischen Prinzip. Nur die Kooperation genügt diesem Anspruch. Die gegenseitige Unterstützung, bezahlt oder nicht, kann nicht nur als allgemeine Regel für alle Menschen gelten, sie ermöglicht auch den Aufbau einer friedlichen gemeinsamen Gesellschaft und Wirtschaft. 2 - Konkurrenz dagegen kann niemals die letzte Grundlage von Gesellschaft und Wirtschaft sein, denn sie trennt nicht nur die Konkurrenten, sondern erhebt gerade die Exklusion zum Prinzip, macht also das Ziel, den Erfolg, nur für Wenige, teils nur für Einen erreichbar. Es ist unmöglich, "Du sollst gewinnen" oder "Du sollst aufsteigen" als moralische Gebote aufzustellen, weil die meisten Menschen bei der Befolgung dieser Regeln scheitern müssen. 3 - Dass die Konkurrenz über den Markt effizient sein kann, muss überraschen. Es ist zunächst völlig widersinnig, dass überhaupt Konkurrenz der Kooperation überlegen sein könnte. Der jedes Sozialismus unverdächtige Schumpeter hatte deshalb noch über die Scharen von Anwälten gespottet, die sich gegenseitig behindern und die der Marsch in den Sozialismus überflüssig machen würde. Das Geheimnis des Marktes ist, dass er dennoch effizient sein kann. 4 - Das Gewinnstreben als erstes Pinzip unserer Wirtschaftsordnung schafft einen permanenten Widerspruch: der Einzelne soll ständig erstreben, was durch die Marktordnung wieder hinwegkonkurriert werden soll; der Einzelne will Gewinn, der Markt will den Gewinn verhindern. Diese Verhinderung soll wiederum gerade durch das Gewinnstreben der Einzelnen bewirkt werden, und je mehr und je härter der Einzelne nach Gewinn strebt, desto weniger soll es dem Einzelnen möglich sein, einen Gewinn zu machen. 5 - Dass der Markt funktioniert, lässt sich weniger theoretisch begreifen als praktisch sehen. Man muss nur auf das China der letzten Jahrzehnte blicken, um die ökonomische Kraft des Marktes vor Augen geführt zu bekommen, mögen die Chinesen auch klug in seiner Anwendung vorgegangen sein und ihm die richtigen Grenzen setzen. 6 - Die Arbeitsteilung schafft eine Ordnung, in der nahezu jeder gezwungen ist, für fremde Interessen wirksam zu sein. Die Tätigkeit selbst ist damit eine durchweg moralische. Erst der Lohn, den der Arbeiter, erst der Preis, den der Unternehmer erhält, macht deren Handlungen zu nicht mehr moralischen und die Ordnung zu einer potentiell gerechten. 7 - Weniges ist so schwer verständlich wie die Bildung von Wert. Soviel ist gewiss: ein Wert ist weder willkürlich noch eindeutig, seine Objektivität speist sich aus dem Subjektiven. Diese Ambivalenz entspricht dem Bedürfnis des Menschen: sowenig sich das konkrete Bedürfnis objektiv nennen lässt, so sicher hat der Mensch objektiv Bedürfnisse. Schon Robinson muss die Welt um sich und seine eigene Zeit bewerten, wenn er sich entscheidet, zu jagen, zu sammeln oder sonst etwas zu tun. Es braucht also keinen Zweiten, keinen Austausch, damit der Wert ein Problem darstellt.
8 - Bedürfnisse sind oftmals, aber niemals nur materieller Art. Jeder muss fressen, aber jeder will auch wissen, warum er frisst. Mögen seine Versuche, eine Antwort zu finden, noch so vergeblich und lächerlich sein, mag er beten, sich schminken oder Gedichte schreiben: der Mensch wird nicht von seiner Suche ablassen und seine Zeit für Dinge verwenden, die keinen messbaren Wert haben. 9 - Die Volkswirtschaftlehre, Marx inbegriffen, neigt dazu, Bedürfnisse aufs Materielle zu reduzieren, weil sich die immateriellen der Messbarkeit entziehen. Dadurch wird die Lehre aber nicht nur unvollständig und realitätsblind. Sie gewinnt zugleich normative Qualität: die Welt, die sie nur zu beschreiben vorgibt, formt sie nun mit, ohne sie natürlich völlig verändern zu können.
10 - Die Bewertung der Bedürfnisse nach dem persönlichen Nutzen ist viel schwerer als es scheint. Mit Hirschman lässt sich feststellen, dass Nutzen ein instabiles, ständig von Veränderung betroffenes Konstrukt ist. Wir wissen selbst kaum, was uns nützt. 12 - Ungeachtet aller Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten bei der Messung von Nutzen, Bedürnissen und Werten bleiben sie etwas Existentes und Ursprüngliches. Erst nach ihnen kommt die Frage, mit welchen Mitteln sie sich erreichen lassen. Die klassische Volkswirtschaftslehre dreht sich de facto fast ausschließlich um die Frage, welches die besten Mittel sind – ohne sich aber dieser Abhängigkeit von vorgegebenen Nutzen, Bedürfnissen und Werten und der daraus folgenen Beschränkheit wirklich bewusst zu sein.
13 - Der Preis folgt dem Wert in seiner subjektiv-objektiven Doppelnatur, entsteht aber erst aus der Äußerung und Durchsetzung von Wertvorstellungen und deren Kumulation. Durch die Knappheit der Ressourcen und die Konkurrenz der Werte der Menschen kann sich der Preis vom Wert fundamental unterscheiden. 14 - Was für die Menschen von Wert ist, zieht ihre Arbeitszeit an. Zumindest sollte es dies tun, wenn das Wirtschaftssystem und das Leben der Menschen nicht umsonst sein wollen. Dies hat zur Folge, dass Wert und Arbeit in einer engen Verbindung stehen und dass hinter den meisten Gütern von Wert auch Arbeit steckt. Ein Umstand, der Marx zu der verkehrten Sicht verleitete, der Wert folge aus der Arbeitszeit, wo es sich eben genau umgekehrt verhält. 15 - So eng nun die Verbindung von Wert und Arbeitszeit auch ist, bleiben doch bedeutsame Fälle, in denen beide fundamental voneinander abweichen: Grundstücke haben ihren Wert, ganz ohne dass Arbeitszeit darauf verwandt wurde, selbst wenn man zugesteht, dass sich dieser Wert auch auf zukünftige Wertsteigerung durch Arbeit bezieht. Arbeitszeit kann verschiedenster Qualität sein. Umgekehrt lässt sich unendlich viel Arbeit denken, die keinerlei Wert schafft oder die in ihrem Wert durch neue Produktionsmethoden entwertet wird. Europa
1 - Die Vereinigung Europas begann als ökonomische Kooperation, gerichtet gegen die kriegerische Konkurrenz der Nationalstaaten. Später trat an die Stelle der Kooperation die ökonomische Konkurrenz nationaler und zunehmend europäischer Unternehmen, deren Interessen auch heute noch dominieren. Deshalb gilt es, an den Ursprung Europas zu erinnern.
2 - So wahr es ist, dass die Europäische Union nach innen trotz aller ökonomischen Konkurrenz ein Friedensprojekt ist, so wenig vermag Europa den Frieden nach außen zu tragen. Im Gegenteil zeichnet sich ab, dass europäische ökonomische Interessen offen mit militärischer Gewalt durchgesetzt werden sollen. Wieder mahnt es: gedenket des Ursprungs! 3 - Diese Warnungen vorneweg geschickt, muss auf das Positive der Union geblickt werden. Nicht nur hat die Union Frieden gebracht, Grenzen niedergerissen und Menschen näher gebracht, sie schickt sich auch in den letzten Jahren in einigen Bereichen an, von der Wettbewerbslogik abzurücken und sich positiv zu integrieren. 4 - Die Verankerung der lokalen Selbstverwaltung, die Stärkung des Europäischen Parlaments und die Einführung des europäischen Referendums im Vertrag von Lissabon sind Zeichen für eine politischere Union, die den Namen einer Demokratie zu verdienen beginnt. 5 - Ein großes demokratisches Problem der EU ist das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit. Vor allem die verschiedenen Sprachen, aber auch die politischen Kulturen in den Mitgliedstaaten verhindern eine solche Öffentlichkeit. Nur die Apparate in Brüssel und die hohe Politik können der Illusion eines politischen Europa erliegen. Ob es jemals gelingen wird, diesen Mangel zu überwinden, ist ungewiss. Flüchtlinge
1 - Die Flucht bleibt, wenn sonst nichts mehr bleibt. Der Flüchtling verlässt sein bisher gelebtes Leben, nur um das Leben selbst oder zumindest das Leben als lebbares zu retten. Indem er flüchtet, gibt er den Kampf auf, seine Heimat zu einem bewohnbaren Ort zu machen. Er verzichtet auf den Heroismus der möglichen Selbstzerstörung, um sich selbst zu erhalten.
2 - Nun sucht der Flüchtling einen Ort, wo er sich Schutz, ein lebbares Leben, ja vielleicht sogar neue Heimat erhofft. Doch weiß er, dass er seine wirkliche Heimat für den Moment verloren hat. Kein Zeitalter, da es dies nicht gäbe: die Flucht, die Hoffnung. 3 - Wo der Flüchtling hin will, erwartet man ihn nicht mit den Hoffnungen, die er selbst hat. Die Menschen dort haben ihre eigenen Hoffnungen, ihr eigenes Leben, das sie schützen wollen. Das konservative Element in allen Gesellschaften setzt den Flüchtling, diesen Ausgestoßenen, zudem dem Verdacht aus, sich selbst ausgeschlossen zu haben, gerade dann, wenn er nicht nur Opfer einer allgemeinen Katastrophe geworden ist. 4 - Oft bleibt dem Flüchtling auf seinem beschwerlichen Weg der Luxus der Legalität verwehrt. Mit einem illegalen Grenzübertritt oder anderen Rechtsverstößen wird er meist von Anfang an gezwungen, sich außerhalb der Rechtsordnung des Landes zu begeben, dessen Schutz er begehrt. Der Verstoß kann geheilt werden, der Makel bleibt haften.
5 - Der Flüchtling muss vom ersten Tag an hoffen, von den Menschen des Schutzlandes verstanden zu werden: als Mensch mit gleichen Rechten, dem es doch anders, schrecklich anders ergangen ist. Werden diese Gleichheit oder dieser Unterschied geleugnet, wird der Flüchtling auf Unverständnis und Ablehnung stoßen. 6 - Der Schutz für Flüchtlinge setzt Menschenrechte voraus. Der Staat ist gewohnt, Grundrechte nur für sein Gebiet oder für sein Volk zu gewähren; mit dem Asylrecht überträgt er diese Rechte auf alle Menschen in der Welt. Dass er sich dabei in die Heuchelei begibt, ist solange unvermeidlich, wie er nicht jeden Menschen schützen kann. 7 - Deutschland hat mit dem Holocaust und vielen anderen Taten des dritten Reichs eine Begründung für den Schutz für Flüchtlinge gegeben, die nie vergessen werden darf. Aber gerade die Ungeheuerlichkeit dieser Taten wird den Flüchtlingen von heute zum Verhängnis: der Kurde aus dem Irak wurde nur mit Gas bombardiert, wer - wie die Juden zu Anfang - ein Berufsverbot hat, kommt doch nur aus wirtschaftlichen Gründen, Bürgerkrieg ist ohnehin weltpolitischer Alltag. 8 - Doch der Erkenntnis, dass es für die Gewährung von Schutz nicht der Nazi-Ungeheuerlichkeit bedarf, können sich kein Einzelner und kein Staat verschließen, die nicht selbst Mitverantwortung für unmenschliche Zustände tragen wollen. Es ist nicht nur unmoralisch, ein Übel zu verursachen, sondern auch, auf dessen Linderung zu verzichten. |